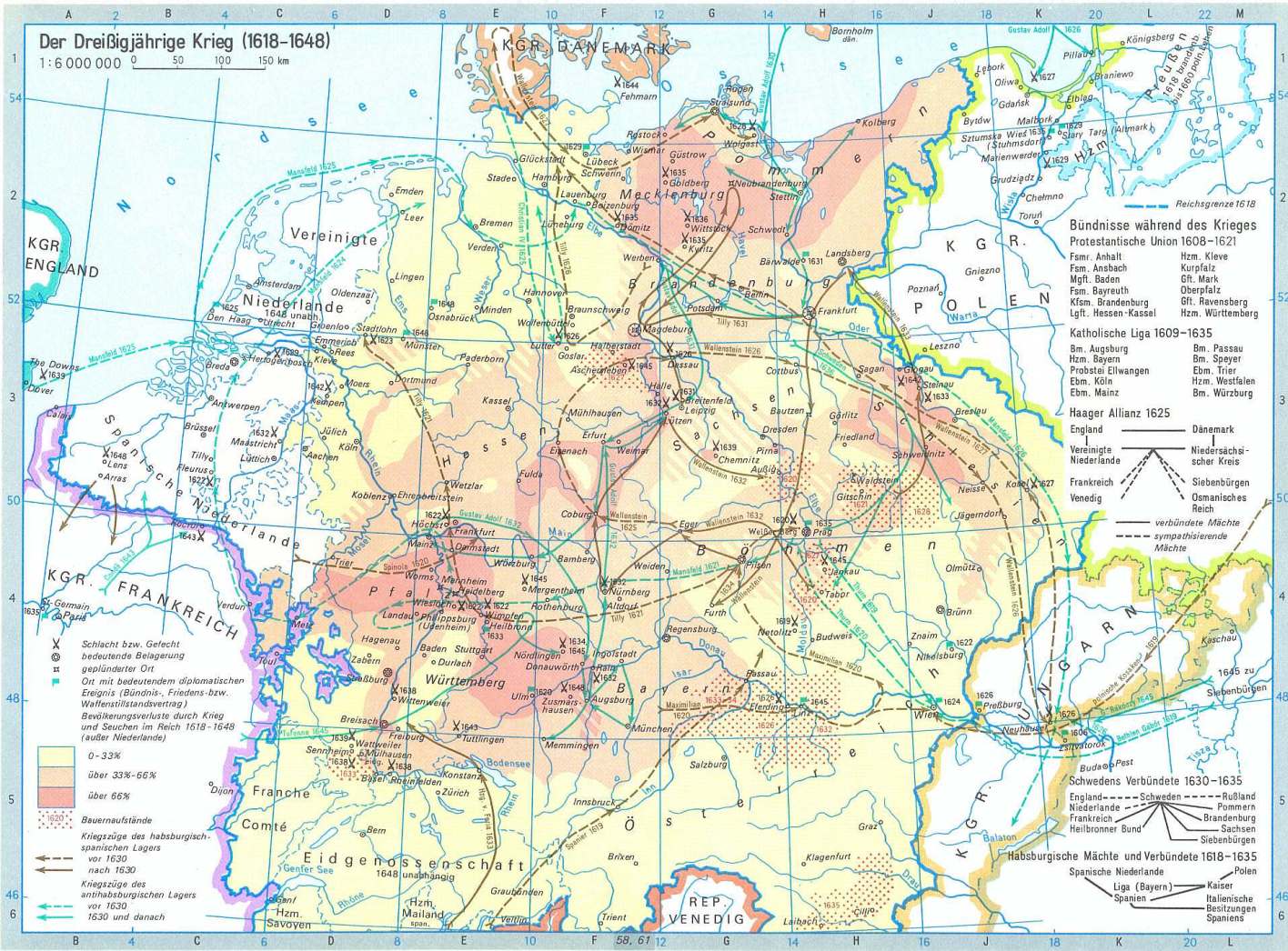1. Vorgeschichte zum 30-jährigen Krieg
Zur Vorgeschichte gehört natürlich die Reformation
des 16. Jahrhunderts und die Bildung von evangelisch-reformierten Ländern oder
Landständen.
Mit dem Augsburger Religionsfrieden von 1555 schien es auch gewährleistet, dass
im Reich deutscher Nation evangelisch-lutherische Länder und katholische Länder
friedlich nebeneinander leben konnten (die nach Zwingli und Calvin reformierten
Länder waren noch nicht eingeschlossen). Allerdings blieb das nicht lange so. Nicht
nur durch die katholische "Gegenreformation" drang vor allem der Kaiser aus dem
Hause Habsburg immer stärker auf die Allmacht der katholischen Kirche und auf
eine Herrschaft auch über die protestantischen Länder.
1608 schlossen sich die protestantischen Länder dagegen zur "Protestantischen
Union" zusammen, zu der etwa 12 Länder, vom Fürstentum Anhalt bis zum Herzogtum
Württemberg (s. dazu unten die Karte) gehörten. Dagegen bildete sich 1609 die
"Katholische Liga", zu der vor allem Bistümer gehörten (von Augsburg bis
Würzburg).
2. Ziele der kriegführenden Mächte und Grausamkeit des Krieges
Was waren die Ziele der kriegführenden Länder im 30-jährigen Krieg? Beim großen 30-jährigen Krieg geht es einmal um die Konfessionen, um die Herrschaft des katholischen Kaisers der Habsburger (Ferdinand II.) auch über die protestantischen und katholischen Fürsten in Deutschland (mit Böhmen) und um die Rettung des Protestantismus; aber auch - und immer mehr - um die Über- Macht der europäischen Großmächte, vor allem Schweden und Frankreich und Habsburg.
Der 30-jährige Krieg ist ein besonders grausamer Krieg. Nicht nur wegen seiner langen Dauer, sondern auch wegen der Art der Kriegführung: Es gab damals kaum stehenden Heere, sondern Söldnertruppen, die ernährt und unterhalten werden mussten. Wallenstein vertrat dafür das Prinzip: "Der Krieg ernährt den Krieg." Die Söldner zogen durch die Dörfer und, wenn möglich, durch die Städte, und holten sich was sie wollten. Dabei wurden auch viele Bauern getötet, und die Häuser und Felder geplündert und verwüstet. Die Zahl der Toten und der Verwundeten durch den 30-jährigen Krieg ist enorm, vollends wo auch noch in den 1630er Jahren eine Pestepidemie das Land traf. Nach Statistiken ist in den hauptsächlich betroffenen Gebieten der Deutschen Fürstentümer die Zahl der Bewohner nach dem 30-jährigen Krieg auf die Hälfte zurückgegangen, in Südwestdeutschland sogar auf ein Drittel.
3. Der große 30-jährige Krieg bestand aus mehreren Einzelkriegen:
1618 - 1623: Böhmisch-Pfälzischer
Krieg:
Beginnend mit dem Prager Fenstersturz 1618, bei dem protestantische böhmische
Ständevertreter Vertreter des katholischen Habsburger- Kaisers in Prag aus dem Fenster warfen,
weil die Böhmen nicht den katholischen Kaiser auch zu ihrem König haben wollten, wählten die
protestantischen Böhmen
den Protestanten Friedrich V. von der Pfalz zum böhmischen König.
Der beginnende Krieg führte
1620 zur großen Schlacht am Weißen Berg bei Prag, der zu einem überlegenen Sieg der
kaiserlichen Truppen und der bayrischen Truppen unter Tilly über Böhmische und
Pfälzer Truppen führte. (Friedrich
V. wurde zum "Winterkönig".)
1625 - 1629: Dänisch-Niedersächsischer Krieg:
Nach dem Sieg über dem Dänenkönig unterwerfen Tilly und Wallenstein gemeinsam
Norddeutschland.
1630 - 1635:
Schwedischer Krieg:
 Auch um die Protestantischen Länder zu retten beschließt
Gustav II. Adolf, König
von Schweden, in Deutschland einzugreifen. 1630 landet er mit Schwedischen Truppen in Pommern.
Auch um die Protestantischen Länder zu retten beschließt
Gustav II. Adolf, König
von Schweden, in Deutschland einzugreifen. 1630 landet er mit Schwedischen Truppen in Pommern.
[Bild (Briefmarke Estland, 1994): 500.
Geburtstaag des schwedischen Königs Gustav II. Adolf (1594 - 1632)]
1631 erobert Tilly mit den kaiserlichen Truppen noch
Magdeburg; er wird aber dann von Gustav Adolf und seinen Truppen in der Schlacht bei Breitenfeld (bei Leipzig)
besiegt.
1632 siegen die Schwedischen Truppen in der Schlacht bei Lützen über die
kaiserlichen Truppen;
allerdings fällt König Gustav II. Adolf, der die Truppen selbst angeführt hatte, in dieser Schlacht.
Die Leitung der
Schweden übernimmt 1633 der schwedische Kanzler Oxenstierna (und später die Tochter Gustav Adolfs).
Oxenstierna gewinnt auch die protestantischen Fürsten der oberdeutschen
Reichskreise zum "Heilbronner Konvent", einer Erneuerung der Protestantischen
Union von 1608.
Und: 1634 wird Wallenstein, der lange die Truppen des Kaisers leitete, in Eger
ermordet, auf Befehl des Kaisers.
1634 siegen die Kaiserlichen Truppen
zusammen mit den Bayerischen Truppen in der für Südwestdeutschland besonders
grausamen Schlacht bei Nördlingen.
 Die
Leitung der kaiserlichen Kavallerie hatte damals, nach dem Tod der Heerführer
Wallenstein und Tilly, Jan van Werth, der nach diesem Sieg bei Nördlingen
zum General befördert wurde.
Die
Leitung der kaiserlichen Kavallerie hatte damals, nach dem Tod der Heerführer
Wallenstein und Tilly, Jan van Werth, der nach diesem Sieg bei Nördlingen
zum General befördert wurde.
[Bild (Briemarke BRD, 1991): 500. Geburtstag des Heerführers Jan von Werth (1591
- 1652)]
[Entwurf der Briefmarke: Elisabeth Janota-Bzowski]
Nach der verlorenen Schlacht bei Nördlingen scheint die Sache der protestantischen Länder verloren zu sein. Der damals in Württemberg herrschende Herzog von Württemberg, Herzog Eberhard III., wird geächtet und flieht, wie andere protestantische Fürsten, ins Exil nach Strassburg. Das Land wird für einige Jahre von kaiserlichen Kommissaren regiert.
1635 - 1648: Schwedisch-Französischer
Krieg:
1635 beschließt das katholische Frankreich an der Seite des protestantischen
Schwedens und der Protestantischen Deutschen Länder in den Krieg gegen die katholischen Kaiserlichen einzugreifen (was
zeigt, dass es hier nicht um eine Konfessionsfrage, sondern um eine europaweite
Machtfrage ging). - Die vereinigten Schweden und Franzosen gewinnen mehrere
Schlachten.
1644 beginnen Friedensverhandlungen, die zum Westfälischen Frieden führen.
4. 1648: Westfälischer Frieden,
geschlossen 1648 in Münster
(Fortsetzung rechte Spalte oben)
6. Karte XII: Geschichts-Karte zum 30-jährigen Krieg, mit Hinweisen auf Bündnisse, Kriegszüge,
Heerführer, Schlachten, besonders stark verwüstete Länder und vernichtete
Bevölkerungen
4. Westfälischer Frieden, geschlossen 1648, nachdem bereits seit 1644 Friedensverhandlungen in Münster und Osnabrück begannen, an denen Diplomaten aller kriegführenden Länder teilnahmen, also auch Gesandte Schwedens und Frankreichs, Vertreter des Kaisers und der katholischen Fürstentümer, und Vertreter der protestantischen Länder und Stände. Dafür 3 Vertreter (die z.T. auf der unten abgebildeten Briefmarken-Tafel abgebildet sind): Maximilian Graf von Trautmannsdorff als kaiserlicher Chefdiplomat, Graf Johann Oxenstierna als Vertreter des schwedischen Königshauses, und Johann Conrad Varnbühler als wichtiger Vertreter von Wirtemberg.
 Am 24. Oktober 1648 treffen sich über 100 Vertreter aller kriegführenden
Länder in Münster und unterschreiben umfangreiche Dokumente zum Beenden des
Krieges und zur Neugestaltung in Mitteleuropa (s. unten)..
Am 24. Oktober 1648 treffen sich über 100 Vertreter aller kriegführenden
Länder in Münster und unterschreiben umfangreiche Dokumente zum Beenden des
Krieges und zur Neugestaltung in Mitteleuropa (s. unten)..
[Bild (Briefmarke BRD, 1998): 350
Jahre Westfälischer Friede; Tafel mit einer Auswahl von 14 Verhandlungspartnern
in Münster und Osnabrück]
[Entwurf der Briefmarke: Manfred Gottschall, nach zeitgenössischen Kupferstichen
des Malers Anselm von Hulle]
Der Friede nach 30 Jahren Krieg
wird in Deutschland mit großen Friedensfeiern gefeiert (auch wenn es noch einige Zeit dauerte
bis die Besatzungstruppen abgezogen waren).
1648: Beschlüsse des Westfälischen Friedens,
die z.T. prägend für die nächsten 2 Jahrhunderte in Mitteleuropa werden sollten:
1. Friede, Ende aller Kriegshandlungen:
Das war wohl für die grausam gequälte Bevölkerung das Wichtigste.
2. Konfessionelle Beschlüsse:
Bestätigung der Beschlüsse des Augsburger
Religionsfriedens von 1555 mit der Religionsfreiheit für die protestantischen
und katholischen Länder. Erweiterungen: Einbeziehung des Calvinisten (die 1555
noch ausgeschlossen waren). Neu: Auch Andersgläubige können im Land leben (außer
in Österreich).
Aufgehoben wurde das Restitutionsedikt von 1629, in dem Kaiser Ferdinand II.
bestimmt hatte, dass alle von den Protestanten eingezogenen geistlichen Güter
wieder an die Kirche zurückgegeben werden müßten.
(Diese Beschlüsse wurden weitgehend eingehalten. Nicht in Frankreich, s. Hugenotten 1685, die
in Frankreich vertrieben wurden und die, s. das
Edikt von Potsdam 1685, im protestantischen Berlin in großer Zahl aufgenommen
werden. Und: Nicht in Österreich,
dem Kernland des Kaisertums, in dem ein Ziel der katholischen Gegenreformation
festgehalten wurde, nämlich die Vertreibung der Protestanten: s. die Vertreibung der Protestanten 1732 aus Salzburg und
deren Emigration nach
Brandenburg, wo sie freudig aufgenommen wurden.)
3. Regionale/ Politische Beschlüsse: 2 Beispiele: Frankreich erhält Teile des Elsass
(und kommt damit einem seiner Ziele immer näher, nämlich den Rhein als Grenze
zwischen Frankreich und Deutschland zu befestigen), dazu Metz, Toul und Verdun.
- Württemberg bleibt
in den alten Grenzen des Herzogtums erhalten, Dank des Verhandlungsgeschicks von Varnbühler,
der als Gesandter des Württembergischen Herzogs an den Friedensverhandlungen
teilnahm.
4. Weitere politische Beschlüsse: Die bisherige fast absolute Macht des Kaisers
wird begrenzt. Dafür nimmt die fast absolute Macht der Fürsten, Reichsstände u.ä.
zu. (Damit etablierte sich der Aufbau
Deutschlands als Staatenbund, der lange Zeit, bis zum Ende des alten Reiches, Gültigkeit haben
wird.)
5. Literatur zum Dreißigjährigen Krieg:
 In
Theaterstücken u.a. Literatur wird der 30-jährige Krieg häufig thematisiert. Hier einige Beispiele aus verschiedenen Jahrhunderten:
In
Theaterstücken u.a. Literatur wird der 30-jährige Krieg häufig thematisiert. Hier einige Beispiele aus verschiedenen Jahrhunderten:
- Von
H.J.C. von Grimmelshausen,
der im 30-jährigen Krieg an vielen Stellen mitkämpfen musste, ist der 30-jährige
Krieg aus den eigenen Erfahrungen in seinem
"Abenteuerlicher Simplicissimus Teutsch" (Veröffentlichung 1669)
thematisiert;
[Bild (Briefmarke BRD, 1976):
Deckblatt von Grimmelshausens "Simplizissimus"]
[Entwerfer der Briefmarke: Günter Jacki]
-
Friedrich Schillers Theaterstück "Wallenstein. ein dramatisches Gedicht in 3
Teilen", (Uraufführung 1799): Vorspiel "Wallensteins Lager"; 1. Teil "Die Piccolomini",
2. Teil "Wallensteins Tod" stellt vor allem die umstrittene Person Wallenstein
in den Mittelpunkt: (Schiller hatte übrigens kurz nach seiner Ernennung zum
Honorarprofessor in Jena als erste größere Veröffentlichung eine Arbeit "über
den 30-jährigen Krieg" geschrieben)
(Auf Wallenstein bezieht sich auch Schillers bekanntes und vielfach
verwendetes Zitat: "Von der Parteien Gunst und Hass verwirrt, schwankt sein
Charakterbild in der Geschichte".)
-
Alfred Döblin schrieb während des 1. Weltkriegs, zwischen 1916 und 1919,
seinen Roman "Wallenstein", in dem der ganze 30-jährige Krieg aus den
Erfahrungen des 1. Weltkrieges beschrieben wird.
 -
Bert Brechts "Mutter Courage und ihre Kinder", Uraufführung 1941
(eine Kriegsgeschichte der Marketenderin Courage im 30-jährigen Krieg);
-
Bert Brechts "Mutter Courage und ihre Kinder", Uraufführung 1941
(eine Kriegsgeschichte der Marketenderin Courage im 30-jährigen Krieg);
[Bild (Briefmarke DDR, 1973): Theaterinszenierungen:
Bert Brecht Regie: Mutter Courage und ihre Kinder.]
[Entwurf der Briefmarke: Lothar Grünewald]
-
bis zu dem neuen Buch von Daniel Kehlmann: "Tyll", in dem Kehlmann die
Geschichte von Till Eulenspiegel in die Zeit des 30-jährigen Krieges verlegt
(erschienen 2017).
Weitere Literaturhinweise:
div.: Der Dreissigjährige
Krieg. 1618 - 1648. Vom Prager Fenstersturz
bis zum Westfälischen Frieden.
GEO Epoche
Nr. 29/ 2008
Herfried Münkler:
Der Dreißigjährige Krieg. Europäische Katastrophe, deutsches Trauma. 1618 -
1648.
Rowohlt - Verlag 2017
6. Karte XII: Geschichts-Karte zum 30-jährigen Krieg, mit Hinweisen auf Bündnisse, Kriegszüge,
Heerführer, Schlachten, besonders stark verwüstete Länder und vernichtete
Bevölkerungen
(Karte XII nach der Karte "Der 30-jährige Krieg" aus dem Atlas
zur Geschichte 1,
VEB Haack Verlag, Gotha/Leipzig, 1981, dort S. 59)
 Manfred
Ebener:
Lexikon
Geschichte Baden+Württemberg
u.a.:
Manfred
Ebener:
Lexikon
Geschichte Baden+Württemberg
u.a.: