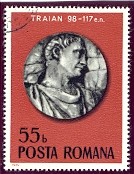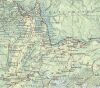Die Römer in Südwestdeutschland
I:
(15 v.Chr.
- 260 n.Chr.)Übersicht über den Artikel in
dieser Spalte:
1. Die
Römer in
Südwestdeutschland: Einleitung
2. Römische "Kaiser" und Römisches Reich:
Daten von ca.
40 v.Chr. bis 290 n.Chr. , vor allem mit Blick auf Germanien:
- bis 44 v. Chr.: Caesar
- seit 27 v. Chr.: Augustus
- seit 41 n.Chr.:
Claudius
- seit 69 n.Chr.:
Vespasian
- seit 81 n.Chr.:
Domitian
- seit 98 n.Chr.:
Traian
- seit 117 n.Chr.:
Hadrian
- seit 138 n.Chr.:
Antoninus Pius
- seit 161 n.Chr.:
Marc Aurel
- 3. Jhdt. n.Chr.: u.a.
Caracalla, Maximinus Thrax und die Überwindung
des Limes durch die Alamannen
- seit 284 n.Chr.:
Diocletian
3. Literaturhinweis zum
Römischen Kaiserreich
1. Die Römer in
Südwestdeutschland (ca. 15 n.Chr. bis 260 n.Chr.)
Einleitung
Die
Römer waren eine bestimmende Macht in Südwestdeutschland für
etwa 275 Jahre, von 15 n. Chr. bis 260 n. Chr. In dieser Zeit waren Teile
Südwestdeutschland von den Römern besetzt, besiedelt und gestaltet.
Allerdings war die Provinz Obergermanien (= Germania Superior) immer
nur Rand-
und Grenzgebiet des römischen Reichs.
 Hier entstanden keine für
das Römerreich bedeutende Weltstädte wie etwa Colonia (=Köln) und
andere Städte am Rhein, oder Augusta Treverorum (=Trier), das unter
Konstantin sogar einige Zeit Hauptstadt des römischen Weltreichs war. Hier entstanden keine für
das Römerreich bedeutende Weltstädte wie etwa Colonia (=Köln) und
andere Städte am Rhein, oder Augusta Treverorum (=Trier), das unter
Konstantin sogar einige Zeit Hauptstadt des römischen Weltreichs war.
[Bild (Briefmarke BRD, 1984: 2000
Jahre Stadt Trier, gegründet um 16 v.Chr.; Porta Nigra in Trier, unter den
Römern um 180 n.Chr. erbautes Stadttor]
[Entwurf der Briefmarke: Otto Rohse]
Aber es entstand in
Südwestdeutschland für 2 Jahrhunderte ein von Rom (genauer: von den römischen Soldaten und ihren
Hilfstruppen, von Veteranen auch aus den Nachbarländern,) dicht bebautes,
gestaltetes und besiedeltes Gebiet, von dem es eine sehr große Zahl von
archäologischen Spuren im Land gibt: Spuren von römischen Strassen, Kastellen,
Limes-Überresten, Siedlungen, Bauernhöfen (villa rustica), Denkmälern u.v.a. -
Als Caesar (60-44 v.
Chr.) Gallien eroberte blieb der Rhein noch, von 2 Stippvisiten Caesars nach
Germanien abgesehen, Westgrenze des römischen Reiches zu Germanien. Wie kam es dann dazu, dass
später auch rechtsrheinische Gebiete, vor allem Südwestdeutschland, von
den Römern besetzt wurde? Und: Wie kam es dazu, dass die Römer gegen 260 n.Chr.
Südwestdeutschland wieder aufgaben und das Land von den Alamannen besiedelt
werden konnte? Hier
werden zunächst in dieser Spalte einige Daten zur Entwicklung des Römischen Reiches mit
Konsequenzen für Südwestdeutschland kurz aufgelistet, ehe dann in der rechten
Spalte die einzelnen
Aspekte der Besetzung Südwestdeutschlands durch die Römer etwas detaillierter beschrieben werden.
2. Römische Herrscher und die
Erweiterung des Römischen Reiches
von ca. 40 v.Chr. bis 290 n.Chr.,
vor allem im Blick auf Germanien
 Bis 44. v.Chr.: Julius Caesar Bis 44. v.Chr.: Julius Caesar
Julius Caesar
aus dem Geschlecht der Julier war seit 44 Diktator und Imperator des römischen
Reiches. Er wird nach einer Verschwörung am 15.3.44 v.Chr., an den Iden des
März, ermordet.
Caesar hatte zuvor Gallien für die Römer erobert. Der Rhein war seitdem die
Grenze des Römischen Reiches.
[Bild (Marke Italien,1928ff): Gaius Julius
Caesar, 100 v. Chr. - 44.v.Chr.]
Caesar hatte noch 1 Jahr vor seiner
Ermordung Gaius Octavius, den späteren Kaiser Augustus, als Sohn adoptiert.
31/27 v.Chr. - 14. n.Chr.: Augustus
Octavian, Adoptivsohn Caesars, läßt sich zum
"Princeps" wählen (der Kaisertitel und der Titel Imperator wurde erst später
vergeben) und erhält den Namen Augustus (= "der Erhabene").
[Es ist der Augustus, von dem nach
der Weihnachtsgeschichte des Lukas-Evangeliums der Bibel die Volkszählung
veranlasst worden sein soll, die die Eltern des späteren Jesus nach Bethlehem
gebracht haben soll.]
Zu Beginn seiner Alleinherrschaft umfasst
das Reich des Augustus ein riesiges Gebiet um das Mittelmeer: Italien als
Kerngebiet, dazu im Westen das heutige Spanien und das durch Caesar eroberte
Gallien (Frankreich) bis zum Rhein. Im Osten erstreckte sich das römische Reich
über Dalmatien, Griechenland, nach Asia (einem Großteil der heutigen Türkei,
dazu Syrien und Judäa um Jerusalem). In Nordafrika gehört Numidien, das Land um
Karthago (heute Tunesien), zum römischen Reich und Cyrene (heute Libyen).
(Ägypten wird erst von Augustus dazuerworben. Außerdem erwirbt Augustus Illyrien
und Pannonien, das sind etwa die Gebiete des heutigen Ungarn und anderer
Balkanländer. Das Gebiet des heutigen Österreich wird als Provinz Noricum dem
Reich eingegliedert.)
-
16 v.Chr.: Augustus läßt an der Rheingrenze große Legionärslager errichten, aus
denen später große Städte mit römischen Wurzeln entstehen, z.B. Mainz, Koblenz,
Bonn, Köln, Neuss.
- 15 v.Chr.: Im Auftrag des Augustus unterwerfen Tiberius und Drusus die
Alpenvölker (keltische Helvetier) bis zur oberen Donau. Die Provinz Rätien wird gegründet. Sie
umfasst einen Großteil der heutigen Schweiz und das Voralpenland. Die
Nordgrenze Rätiens wird bis zur Donau vorgeschoben..
 Augsburg (=Augusta Vindelicum) wird zur Hauptstadt der Provinz Rätien. Augsburg (=Augusta Vindelicum) wird zur Hauptstadt der Provinz Rätien.
[Bild (Briefmarke BRD, 1985): 2000 Jahre
Augsburg, gegründet um 15 v.Chr. zur Zeit des Kaiser Augustus als Augusta
Vindelicum; Bronzebüste des Kaiser Augustus, wichtige Bauwerke Augsburgs,
Stadtwappen]
[Entwurf der Briefmarke: Vollbracht] - 9.n.Chr.: Tiberius
und Drusus wollen / sollen auch die Germanenstämme rechts des Rheins besiegen, das
Römische Reich bis zur Elbe ausdehnen.
In der "Varusschlacht",
meist als Schlacht im
Teutoburger Wald bezeichnet, werden die Römer 9 n.Chr. geschlagen: Der
römische Feldherr Quinctilius Varus sollte im Auftrag von Kaiser Augustus die
weiten Gebiete Germaniens besetzen, er wurde aber mitsamt 3 hochgerüsteten
Legionen von den Germanen unter Führung des Cheruskerfürsten Arminius (auch:
Hermann) vernichtend geschlagen. Nach diesem Wendepunkt geben die Römer das Ziel
der Ausdehnung nach Germanien bis zur Elbe auf.
Nach der verlorenen Varusschlacht
wird auch Obergermanien von den Römern erst einmal aufgegeben.
14 n.Chr. - 37 n.Chr.: Tiberius
37 n.Chr. - 41 n.Chr.: Caligula
 41 n.Chr.
- 54 n.Chr.:
Claudius: 41 n.Chr.
- 54 n.Chr.:
Claudius:
-
Unter Claudius
wird
der Süden Britanniens erobert und die Provinz Britannien errichtet.
-
Im Blick auf Südwestdeutschland werden unter Claudius die Grenze der oberen Donau und der Rheinübergang
durch Kastelle gesichert.
[Bild (Marke Großbritannien, 1993): Portrait Kaiser Claudius auf einer
Goldmünze, gefunden in Bredgar in Britannien]
54 n. Chr. - 68 n.Chr.: Nero
68 n,Chr: Galba, Otho, Vitellius (regieren jeweils
kurze Zeit zwischen 68 und 69, "Vierkaiserjahr")
69 n.Chr. - 79 n.Chr.:
Vespasian.
Unter Vespasian
beginnt die Besetzung des Neckarlandes
(in dem vermutlich nur noch wenige Kelten lebten, da sich die meisten schon
wegen der andrängenden Germanen ins Gebiet der heutigen Schweiz zurückgezogen
hatten),
die Sicherung des Landes durch Kastelle, und der Bau guter
Straßenverbindungen zwischen Donau und Rhein. Der Grund war wohl vor allem ein strategischer: Um
Truppenbewegungen zwischen den weit auseinanderliegenden römischen
Unruheprovinzen durchführen zu können war eine möglichst kurze
Straßenverbindung wichtig. Die wurde bisher durch den keilförmig ins römische
Gebiet hereinragende fremde Gebiet zwischen Rhein und Donau verhindert. - Konkreter Anlass war wohl ein
Aufstand der Batavier (im Gebiet der heutigen Niederlande), zu dem dringend
Truppen aus Südosteuropa gelangen sollten.
79 n.Chr.: Ausbruch des Vesuv; Zerstörung Pompejis
79 n.Chr. - 81 n.Chr.: Titus:
[Er ist mehr dafür bekannt, dass unter ihm der
Aufstand in Palästina / Judäa niedergeschlagen wird, der Tempel in Jerusalem zerstört und den
Juden verboten wird in Jerusalem zu leben.]
81 n.Chr. - 96 n.Chr.:
Domitian.
Domitian war ein besonders
grausamer Kaiser. [In seiner Zeit schreibt übrigens Tacitus das später so berühmt
gewordene "Germania".]
Unter Domitian wird der Neckarlimes als neue Grenze in Obergermanien errichtet.
Vermutlich beginnt schon in dieser Zeit die
Besiedlung des Landes hinter dem Limes und seinen Kastellen und auch der
planmäßige Verwaltungsaufbau mit seinen Bauernhöfen (Villa rustica), seinen
Siedlungen und den Verwaltungsorten (vici).
96 n.Chr. - 98 n.Chr.: Nerva
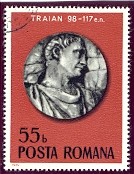 98 n.Chr.
- 117 n.Chr.:
Trajan. 98 n.Chr.
- 117 n.Chr.:
Trajan.
Bei ihm steht der
Sieg über die Dakier im heutigen Rumänien, ein bis dahin noch weißer Fleck auf
der römischen Landkarte, im Vordergrund. Außerdem erweiterte er im Osten das
Reich durch die Kriege mit den Parthern durch die Einnahme Armeniens, Assyriens
und Mesopotamiens. Trajan läßt sich für seine Siege auf vielen
Trajanssäulen feiern. - Aber es wird schon deutlich dass das Riesenreich kaum
mehr regierbar ist.
[Bild (Marke Rumänien, 1975): Kaiser Trajan, regiert
von 98 - 117 n.Chr.]
 117 n.Chr.
- 138 n.Chr.:
Hadrian. 117 n.Chr.
- 138 n.Chr.:
Hadrian.
Hadrian ist mehr
auf Sicherung des Reiches bedacht. Er gibt die Gebiete im Osten (Armenien,
Assyrien und Mesopotamiens) wieder auf.
Im Westen bemüht er sich um die Sicherung und Befestigung der Grenzen zu den
eindringenden Germanengruppen.
[Bild (Marke Großbritannien 1993): Portrait Kaiser
Hadrian, Bronze gefunden in der Themse in Britannien]
- Unter Hadrian wurde in Britannien an der Grenze zum
heutigen Schottland der
 Hadrianswall
gebaut, der durchaus mit dem Limes in Südwestdeutschland vergleichbar ist. (Der
Hadrianswall wurde auch gemeinsam mit dem Limes zum Weltkulturerbe ernannt.) Hadrianswall
gebaut, der durchaus mit dem Limes in Südwestdeutschland vergleichbar ist. (Der
Hadrianswall wurde auch gemeinsam mit dem Limes zum Weltkulturerbe ernannt.)
- Unter Hadrian wurde der Rätische Limes ausgebaut, mit dessen Bau schon unter
Trajan begonnen worden war.
[Bild (Marke Italien, 2009): Hadrianswall im Norden
von Britannien.]
138 n.Chr. - 161 n.Chr.: Antoninus Pius.
Unter Antoninus Pius, wird der Neckar-Odenwald-Limes
um etwa 30 km vorverlegt (s. unten). Der strategische Grund für diese
Veränderung ist unklar.
161 n.Chr. - 169: Lucius Verus
161 n.Chr. - 180 n.Chr.: Marc Aurel.
Zur Zeit Marc Aurels waren die Römer mit einem langdauernden Krieg gegen die
Markomannen beschäftigt, die von Norden die Donau überschritten hatten und in
Rätien eingebrochen waren. Erst 180 waren die Markomannen abgewehrt.
Nach Marc Aurel wird die Herrschaft der Römischen
Herrscher immer chaotischer. Am schwierigsten war das zur Zeit der sog.
"Soldatenkaiser", wo gelegentlich auch mehrere Herrscher in einem Jahr an der
Macht waren; es waren auch meist "Kaiser" die nicht aus Rom kamen, sondern aus
den Heeren der früheren Hilfstruppen im Osten oder im Westen.
Unten werden nur noch die Namen der Herrscher aufgereiht, die meist unbedeutend
waren, durch die Ermordung des amtierenden Herrschers an die Macht kamen, und
meist nur eine kurze Regierungszeit hatten.
Herrscher seit Marc Aurel (mit Beginn der
Regierungszeit):
Commodus (seit 180), Pertinax (192), Didius Julianus
(193), Septimius Severus (193 - 211);
Caracalla (211 - 217), Geta (211), Macrinus (217), Eingabal (218), Severus Alexander (222 - 235),
Maximinus Thrax (235 - 238), Gordian I.,
Gordian II, Pupienus, Balbinus, Gordinian III. (alle 238), Philippus Arabs
(244), Decius (251), Trebonianus Gallus (251), Aemilianus, Valerian (beide 253),
Gallienus (260), Claudius Gothicus (268), Quintilius, Aurelian (beide 270),
Tacitus (257), Florianus, Probus (beide 276), Carus (282), Carinus (283),
Numerianus (283), Diocletian (284 - 305).
Im
3. Jahrhundert,
in
der Zeit der schlimmsten Herrschaftskrise der Römer und der größten
Überforderung des Römischen Reiches, löste sich die Sicherheit der Bevölkerung
im "Dekumatenland" hinter dem Limes auf, bis der Limes um 260 von den römischen
Truppen vor den vordringenden Alamannengruppen ganz aufgegeben wurde:
213 regierte in Rom als Kaiser Marcus
Aurelius Severus Antoninus, genannt Caracalla (reg. 211 - 217), ein
besonders brutaler Tyrann. (So ließ er 211 seinen Bruder und Mitkaiser zur
Beseitigung des möglichen Konkurrenten gleich brutal ermorden.)
Bekannt ist
Caracalla - außer als Soldat - auch noch geworden durch den Weiterbau und die
Fertigstellung der römischen Thermalbäder, die als "Caracalla-Thermen" mit
seinem Namen verbunden wurden. (Vermutlich ließ Caracalla auch die Thermen im
heutigen Baden-Baden ausbauen und hat sie wohl auch genutzt.)
Bedeutung hat Caracalla auch gewonnen durch ein
wichtiges Gesetz, durch das alle freien Männer, die im Bereich des römischen
Reiches lebten, römische Vollbürger werden konnten (ein Gesetz, das wohl vor
allem mehr steuerpflichtige Bürger schaffen sollte). -
Vor allem bekannt
ist Caracalla aber als Soldat und Kriegsführer zum Beispiel am Limes, wo
ihm seine Erfolge
auch den Titel "Germanicus Maximus" einbrachten:
213, als in Rom Caracalla regiert,
erscheinen immer mehr Gruppen von Alamannischen Reiterkriegern aus dem
Land jenseits des Limes und dringen ins Gebiet südlich und westlich des Limes
ein; sie
konnten wohl von den Soldaten am Limes zunächst nicht gehindert werden. (Übrigens taucht
in diesem Zusammenhang zum ersten Mal bei dem griechisch-römischen
Geschichtsschreiber Cassius Dio der Name "Alamannen" auf, der vorher bei den
Römern nicht bekannt war.)
Caracalla bekämpft die eingedrungenen Alamannen von Rätien aus. Er zieht ein
großes Heer zusammen, vermutlich in und um das größte Reiterkastell am Limes,
das Kastell bei Aalen. Mit diesem Heer verfolgt er die Alamannen bis an
den Main und schlägt sie weit zurück.
Dieser Caracallafeldzug von 213, der im Jahr 2013 vor 1800 Jahren stattfand,
wird um Aalen im Jahr 2013 ausführlich "gefeiert" und nachgestellt und
nacherlebt. Er gilt auch als wichtiges landesgeschichtliches Ereignis: als
erstes zeitlich genau bekanntes und nachweisbares Ereignis im Gebiet
Baden-Württembergs.
- Weitere Web-Informationen
zum Caracalla-Feldzug:
http://www.caracallafeldzug.de
Unter Caracalla wurden später auch noch die
Palisaden des rätischen Limes durch eine massive, etwa zweieinhalb Meter hohe Mauer
ersetzt.
Gestorben ist Caracalla bereits 217, "standesgemäß" ermordet auf einem
Kriegszug gegen die Parther im Osten des römischen Reiches.
233, unter Severus Alexander, stoßen die Alamannen erneut vor, bis in die Gegend von Cannstatt.
Severus Alexander ist zunächst mit dem Krieg in Syrien beschäftigt; er wird von
den römischen Soldaten aus dem Limes-Gebiet gedrängt die Alamannen
zurückzuschlagen.
235 schlägt Severus Alexander einige kleinere Schlachten gegen
Alamannengruppen; dann will er, des Kämpfens müde, mit den Alamannen
Verhandlungen aufnehmen. Daraufhin kommt es unter den römischen Soldaten zu
einer empörten Soldatenrevolte, Severus Alexander wird bei Mainz von seinen
Soldaten ermordet.
An der Stelle des ermordeten Severus Alexander wird
von den Soldaten Maximinus Thrax zum neuen Kaiser ausgerufen.
(Maximinus Thrax war der erste Römische "Kaiser", der nicht aus Rom stammte. Er
stammte aus Thrazien, worauf schon sein Beiname Thrax hinweist. Und: Mit ihm
beginnt auch die chaotische Zeit der Soldatenkaiser, d.h. der Kaiser die vom
Heer, oder von einem Teil des Heeres, von den Soldaten, zum Kaiser gemacht
werden.)
236, unter Maximinus Thrax, werden die Alamannen durch persische Panzerreiter
noch einmal zurückgeschlagen. Einige der zerstörten Limeskastelle werden wieder
aufgebaut.
254 kommt es zu neuen Überfällen der
Alamannen, die nach Rätien und in die Nordschweiz vordringen. Zu dieser Zeit
herrscht als Kaiser Valerian (253 - 260). Er ist ganz mit den Kämpfen im
Osten des Römischen Reiches beschäftigt und beauftragt seinen Sohn Gallienus
mit der Verteidigung im Westen. Gallienus kann auch in mehreren Gefechten die
Alamannen zunächst hinter den Limes zurückschlagen.
259/260,
als sogar Valerian im Osten
von den Parthern gefangen war und Gallienus zu schwach zur Verteidigung des
Limes war, gibt es für die Alamannen
kein Halten mehr durch den Limes. Es gab kaum noch Soldaten zur Verteidigung des
Limes; sie wurden meist gebraucht und abgezogen für die Kämpfe im Osten (oder
sie starben an der Pest, die die Soldaten schon zur Zeit von Kaiser Marc Aurel
von den Kämpfen im Osten mit eingeschleppt hatten). So
besetzen die Alamannen die verwaisten römischen Kastelle und die Wachttürme am
Limes, vernichten die Siedlungen und die
Villa rustica und besetzen das Land bis zum Rhein: Die Überwindung des Limes
war um 260 wohl perfekt, auch wenn manche Vorgänge im einzelnen noch nicht
ganz klar sind.
(Die bisherige Bevölkerung
war wohl zum größten Teil schon geflohen. Darauf deuten auch die vielen
Schatzfunde der Archäologen in Verstecken unter den Häusern hin: Vermutlich
hatten die Bewohner vor der Flucht in Eile ihre Wertgegenstände vergraben, in
der Hoffnung, dass sie bald wieder zurück kommen könnten, wenn sich die Lage
beruhigt hätte.)
284 ff:
Diocletian, mit dem das Römische Reich wieder in
geordneteres und ruhigeres Fahrwasser kam, hat dann die Übernahme des Landes
durch die Alamannen als endgültig akzeptiert und die Nordgrenze des Römischen
Reiches am Hochrhein ausgebaut (Donau-Iller-Rhein-Limes).
Unklar und in der Forschung umstritten ist es, ob die Besetzung des Landes durch
die Alamannen nach 260 evtl. von den Römern sogar förmlich durch Verträge
akzeptiert wurde. Aber auch das ändert nichts daran, dass die Zeit der Römer in
Südwestdeutschland seit ca. 260 n.Chr. zu Ende ist.
Bis
476
n.Chr.: Es gibt auch nach 260 immer wieder Begegnungen von Römern und Alamannen
in Südwestdeutschland:
Kämpfe (meist von Gallien aus), auch Verträge, aber keine Besetzung
des Limes und des Landes durch die Römer.
 Auch
gab es immer wieder Abwehrkämpfe der Römer gegen die Alamannen, die mehrfach
über den Rhein in das römische Gallien vordrangen, gelegentlich auch in den
Süden bis nach Italien. So hat z.B. der später "Konstantin
der Große" genannte römische Herrscher in seiner Zeit als "Caesar" seit 306
von Trier aus mehrere Abwehrschlachten gegen die über den Rhein vordringenden
Alamannen geschlagen. Auch
gab es immer wieder Abwehrkämpfe der Römer gegen die Alamannen, die mehrfach
über den Rhein in das römische Gallien vordrangen, gelegentlich auch in den
Süden bis nach Italien. So hat z.B. der später "Konstantin
der Große" genannte römische Herrscher in seiner Zeit als "Caesar" seit 306
von Trier aus mehrere Abwehrschlachten gegen die über den Rhein vordringenden
Alamannen geschlagen.
[Bild (Briefmarke San Marino 2013): 1700.
Jahrestag des "Edikts von Mailand"; Abbildung: Medaillon von 315 mit Kaiser
Konstantin in Siegerpose, Landkarte mit dem römischen Reich, Christus-Zeichen]
Im Jahr 476 ist dann das römische
Weltreich mit der Absetzung des letzten römischen Kaisers Romulus Augustulus
durch den Germanenführer Odoaker insgesamt zu Ende.
Die Zeit der Römer im Neckarland hat so insgesamt
etwa 190 Jahre gedauert, von ca. 70 n.Chr. bis ca. 260 n.Chr. (An den
Randgebieten des heutigen Baden-Württemberg waren es etwa 85 Jahre mehr.)
3. Literaturhinweis zum
Römischen Kaiserreich:
Div.: Rom. Die Geschichte des Kaiserreichs. 27
v.Chr. - 476 n.Chr.
GEO Epoche. Das Magazin für Geschichte. Nr. 54. Gruner + Jahr, 2012 |
Die Römer in Südwestdeutschland
II:
(15 v.Chr.
- 260 n.Chr.) Übersicht über den Artikel in
dieser Spalte:
4. Die Besetzung Südwestdeutschlands durch
die Römer
4.1 Die Bewohner des Landes vor den Römern
4.2 Die Errichtung der Provinz
Rätien um 15 v.Chr.
4.3 Die Besetzung des
Neckarlandes ab 50 n.Chr. und die Errichtung des Limes.
4.4 Die Errichtung der Kastelle
und die Soldaten 5. Die
Besiedlung des Landes hinter dem Limes
5.1 Besiedelung
durch eine "Mischbevölkerung" seit 75 n.Chr.
5.2 Bau der großen
Straßen im Land
5.3 Entstehung von Dörfern
und Städten
5.4 Entstehung und Betrieb
der Gutshöfe (villa rustica)
5.5 Religionen im
römischen Siedlungsland
6. Das Ende der Römerzeit in Südwestdeutschland:
Die Überwindung des Limes durch die Alamannen
7. Weitere Informationen:
Web-Informationen und Literaturhinweise
4. Die Besetzung Südwestdeutschlands durch die Römer:
4.1 Die Bewohner des Landes vor den Römern:
Das Gebiet des heutigen Südwestdeutschland war einige Jahrhunderte von den
Kelten besiedelt. Um die Jahrtausendwende war allerdings das Land nur noch
sehr dünn besiedelt. Die Kelten hatten sich vermutlich weitgehend aus dem Land
zurückgezogen, wohl auch vertrieben durch die gelegentlichen Germanenüberfälle
beim Durchzug von Germanengruppen nach Italien. Das Gebiet der heutigen Schweiz
wurde zum Rückzugsort für einige Kelten, besonders die keltischen Helvetier.
.4.2 Die Errichtung der Provinz Rätien
und des Legionslagers Mainz um 15 v.Chr.:
15 v.Chr.: Im Auftrag des Augustus unterwerfen Tiberius und Drusus die
Alpenvölker (keltische Helvetier) bis zur oberen Donau. Die Provinz Rätien wird gegründet.
Sie umfasst einen Großteil der heutigen Schweiz und das Voralpenland. Die
Nordgrenze Rätiens wird bis zur Donau vorgeschoben. (Das Neckarland gehört
zunächst nicht zu den Römern und auch nicht zu Rätien; s. dazu die Karte unten.)
 13/12
v.Chr. wird vermutlich auch von Drusus ein Legionärskastell in Mogontiacum
(Mainz) als Brückenkopf in Germanien am Rhein und Main errichtet. [Die Gründung
des Legionärskastells gilt als Geburtsstunde der Stadt Mainz. (Sie fand
allerdings nicht, wie lange vermutet und auf der Briefmarke suggeriert, 38 v.Chr.
statt, sondern etwa 12 v. Chr.)] Drusus starb kurz darauf, 9 v.Chr., in
Mogontiacum bei einem Reiterunfall. Zur Erinnerung wurde spätestens 100 n.Chr.
der monumentale "Drususstein" errichtet, ein riesiger Kenotaph für den in Rom
begrabenen Drusus. 13/12
v.Chr. wird vermutlich auch von Drusus ein Legionärskastell in Mogontiacum
(Mainz) als Brückenkopf in Germanien am Rhein und Main errichtet. [Die Gründung
des Legionärskastells gilt als Geburtsstunde der Stadt Mainz. (Sie fand
allerdings nicht, wie lange vermutet und auf der Briefmarke suggeriert, 38 v.Chr.
statt, sondern etwa 12 v. Chr.)] Drusus starb kurz darauf, 9 v.Chr., in
Mogontiacum bei einem Reiterunfall. Zur Erinnerung wurde spätestens 100 n.Chr.
der monumentale "Drususstein" errichtet, ein riesiger Kenotaph für den in Rom
begrabenen Drusus.
[Bild (Briefmarke BRD 1962): 2000
Jahrfeier der Stadt Mainz; Ausschnitt aus dem Stadtbild von Mainz, mit den
Resten des Drusussteins, einem monumentalen Denkmal, Kenotaph, für den
"Stadtgründer" Drusus]
[Entwurf der Briefmarke: E. Ege]
Mogontiacum/Mainz liegt ja außerhalb des
Neckarlandes. Es spielte aber nach der Errichtung des Limes eine wichtige Rolle
als Verwaltungshauptstadt in der Provinz Germania Superior (Obergermanien).
4.3 Die Besetzung des Neckarlandes ab 50 n.Chr.
durch die Römer und die Errichtung der verschiedenen Formen des Limes: 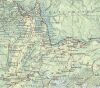 Die
Besetzung und Besiedelung Südwestdeutschlands erfolgt dann ab 50 n.Chr. in mehreren
Phasen (siehe die Karte Obergermaniens): Die
Besetzung und Besiedelung Südwestdeutschlands erfolgt dann ab 50 n.Chr. in mehreren
Phasen (siehe die Karte Obergermaniens):
[Karte
(nach Putzgers Historischem Weltatlas): Römer in Südwestdeutschland:
Provinzen, Römerstraßen, Limes, Kastelle, Landstädte; blau sind die
heutigen Ortsnamen angegeben] [Vergrößerung
der Karte durch Anklicken] Um
50
n.Chr., unter Kaiser Claudius, werden die obere Donau (Hüfingen)
und der Rheinübergang (Sasbach) durch Kastelle gesichert. Eine Straße
entlang der Donau verbindet die Kastelle.
Um
74
n.Chr., unter Kaiser Vespasian, wird das obere Neckargebiet von den Römern besetzt. Bau einer Rhein-
Donau- Straße von Straßburg über Offenburg nach Rottweil
und Tuttlingen. Gründung der Stadt Arae Flaviae (= Rottweil).
Um eine
kürzere Verbindung für die Truppenbewegungen von der Donau zum
Rhein zu erhalten wird die wichtige Römerstraße von Augsburg nach
Mainz gebaut: über Plochingen, Cannstatt, Schwieberdingen, Stettfeld, Heidelberg
nach Mainz. (Auf dieser Route, die heute etwa der Bundesstraße
10 entspricht, verläuft später auch die Postroute von Innsbruck
nach Mecheln.)
Um
90
n.Chr., unter Kaiser Domitian, wird der
Neckarlimes als neue
Grenze errichtet. Kastelle werden z.B. in Köngen, Benningen, Walheim, Wimpfen
gebaut.
Unter Kaiser Trajan und Hadrian wird dieser Limes weiter ausgebaut und befestigt Um
150
n.Chr., unter Kaiser Antoninus Pius, wird der
Neckar-Odenwald-Limes
um etwa 30 km vorverlegt. Der neue Limes folgt keiner natürlichen
Grenze sondern er wird schnurgerade durch den Wald gezogen und befestigt.
An dem neuen Limes liegen Kastelle (insgesamt werden im Gebiet Südwestdeutschlands
70 römische Kastelle gezählt) und Dörfer, auf deren Gebiet
später Städte wie Öhringen, Murrhardt, Lorch entstehen.
-
Um 150 n.Chr. wird auch der Rätische Limes auf den Nordhang des Remstals
vorverlegt (Aalen).
Limes
nennt man den römischen
Grenzwall in Germanien, mit Wall und Graben und teilweise mit Steinmauern
befestigt; er war durch etwa 1000 Wachttürme und 70 - 100 Kastelle
gesichert. Der Limes sollte
die römischen Eroberungen in Obergermanien (das "Dekumatenland" mit den römischen Gutshöfen
und Orten) schützen und die kurzen Verbindungsstraßen von der
Donau zum Rhein. Dabei hatte der Limes nicht nur militärische Funktionen. Er
sollte auch einen geregelten Durchgang des Handelsverkehrs (einschließlich
Zollerhebung) ermöglichen. Der
Rätische Limes trifft bei Lorch den Obergermanischen Limes, der über
den Main bis zum Rhein bei Neuwied führt.
Viele Städte sind am
Ort römischer Kastelle errichtet, z.B. Lorch,
Welzheim,
Murrhardt,
Mainhardt; Cannstatt, Walheim.
-
Weitere Web-Informationen zum Limes und der Limesstraße: http://www.limesstrasse.de
.4.4 Die Errichtung der
Kastelle und die Soldaten
In den Kastellen am Limes wohnten viele Legionen römischer Soldaten,
Fußsoldaten und Reitersoldaten. Das vermutlich größte Kastell, Aalen,
hatte Platz für ca. 1000 Reitersoldaten, Für den Dienst am Limes war dazu noch eine
erheblich größere Zahl von "Auxiliares" angeworben, das waren
Hilfstruppen meist aus den eroberten Ländern (z.B. aus Gallien, aus Britannien,
oder aus den Provinzen im Osten). Diese Hilfstruppen erhielten nach 20 - 25
Jahren Dienst im Heer das römische Bürgerrecht.
Geht man von 100 Kastellen aus, zu denen jeweils im Durchschnitt für jeden etwa
300 Soldaten und Auxiliares Platz hatten, dann wären bei voller Besetzung etwa
30.000 Soldaten im Land gewesen. (Zu einer Legion gehörten etwa 5000 bis 6000
Mann; 80 Soldaten bildeten eine Centurie, 6 Centurien bildeten eine Kohorte.)
 In
Welzheim wurden Teile des kleineren "Ostkastells"
ausgegraben und zu einem archäologischen Park gestaltet. Am eindrucksvollsten
ist dabei die Rekonstruktion des westlichen Toreingangs mit den beiden Türmen. -
Eine beigestellte Übersichtsplastik macht die Lage der Kastelle bei Welzheim
deutlich: Es gab noch ein sehr viel größeres zweites Kastell bei Welzheim, das
"Westkastell", das aber nicht ganz ausgegraben und gesichert werden konnte.
Zwischen den beiden Kastellen lag das Dorf (vicus), das auch fast ganz von der
Stadt Welzheim überbaut ist. Die beiden Kastelle liegen am Limes, wobei das
Ostkastell merkwürdigerweise und fast einmalig außerhalb des Limes liegt. In
Welzheim wurden Teile des kleineren "Ostkastells"
ausgegraben und zu einem archäologischen Park gestaltet. Am eindrucksvollsten
ist dabei die Rekonstruktion des westlichen Toreingangs mit den beiden Türmen. -
Eine beigestellte Übersichtsplastik macht die Lage der Kastelle bei Welzheim
deutlich: Es gab noch ein sehr viel größeres zweites Kastell bei Welzheim, das
"Westkastell", das aber nicht ganz ausgegraben und gesichert werden konnte.
Zwischen den beiden Kastellen lag das Dorf (vicus), das auch fast ganz von der
Stadt Welzheim überbaut ist. Die beiden Kastelle liegen am Limes, wobei das
Ostkastell merkwürdigerweise und fast einmalig außerhalb des Limes liegt.
[Bild (Foto M. Ebener): Kastell
Welzheim: Rekonstruiertes Westtor am Welzheimer Ostkastell, im Vordergrund
Übersichtsmodell zur Lage der Welzheimer Kastelle, des Dorfes und des Limes.]
5. Die Besiedelung des Landes hinter dem Limes
5.1 Besiedelung durch eine "Mischbevölkerung" ab 75 n.Chr.
Das Land zwischen Limes und
Rhein wird ab etwa 75 n.Chr. zunehmend besiedelt.
Die Siedler, Bauarbeiter, Handwerker, Verwaltungsmitarbeiter u.a.
waren dabei - ähnlich wie bei den Soldaten - keineswegs nur Römer, sondern es war wohl eine Mischbevölkerung von
Menschen unterschiedlicher Herkunft: Neben Römern, Veteranen des Heeres,
Veteranen der Auxiliar-Truppen, auch Händler und Handwerker aus Gallien, wohl
auch einzelne Germanen-Gruppen, und Reste der keltischen Vor-Bevölkerung.
5.2 Bau der großen Strassen im Land
Die grossen Strassen (vor allem die Rhein-Donau-Strasse und die
Strasse von Augsburg nach Mainz) wurde nach römischem Muster gebaut: Die Strassen
waren 7 - 9 Meter breit, mit einer leichten Wölbung in der Mitte und mit
Wasserabflussrinnen an den Seiten. Die Strassen hatten einen festen steinernen
Unterbau und einen schotterartigen Belag. (Bei Benningen im Kreis Ludwigsburg
ist noch ein Stück der alten Römerstrasse konserviert und zu besichtigen.) Die
Strassen waren vor allem für die Soldaten geplant, für die Bewegung von
Fußtruppen und Reitersoldaten.
Aber
auch andere konnten die Strassen verwenden: Landwirte, Händler,
Verwaltungsleute, Politiker.
 [In
Novaesium (Neuss) wurde eine Grabstele aus dem 1. Jahrhundert gefunden, auf dem
ein Roßknecht mit Pferd abgebildet ist - ein Bild vom eher alltäglichen Leben in
den römischen Gebieten und auch auf den Strassen.] [In
Novaesium (Neuss) wurde eine Grabstele aus dem 1. Jahrhundert gefunden, auf dem
ein Roßknecht mit Pferd abgebildet ist - ein Bild vom eher alltäglichen Leben in
den römischen Gebieten und auch auf den Strassen.]
[Bild (Briefmarke BRD 1984): 2000 Jahre
Stadt Neuss, von den Römern als Novaesium gegründet 16 v.Chr.; Abbildung
Roßknecht mit Pferd, Ausschnitt der in Neuss gefundenen Grabstele eines Octatius
aus dem 1. Jahrhundert]
[Entwurf der Briefmarke: Rolf Lederbogen]
Es gab auf den Strassen Meilensteine mit Entfernungsangaben bis zu einem
nächsten Ort. (Solche "Leugensteine", so genannt nach dem keltischen
Entfernungsmass, der Leuge, wurden öfter gefunden bei archäologischen
Ausgrabungen.)
An diesen Strassen gab es auch eine Art Postdienst zur Überbringung von
Botschaften. Und es gab Rasthäuser und wohl auch Stationen zum Pferdewechsel.
 Und
es gab zur Orientierung wohl auch Landkarten mit den wichtigsten Bergen
und Flüssen und Strassen, auch mit den wichtigsten Orten. Solche Karten könnten
ausgesehen haben wie die berühmten
Peutinger-Tafeln einer römische Weltkarte von 250 n.Chr., die der Augsburger
Stadtschreiber Peutinger aufbewahrte, wenn auch nur eine im 12. Jahrhundert entstandene Kopie) Und
es gab zur Orientierung wohl auch Landkarten mit den wichtigsten Bergen
und Flüssen und Strassen, auch mit den wichtigsten Orten. Solche Karten könnten
ausgesehen haben wie die berühmten
Peutinger-Tafeln einer römische Weltkarte von 250 n.Chr., die der Augsburger
Stadtschreiber Peutinger aufbewahrte, wenn auch nur eine im 12. Jahrhundert entstandene Kopie)
[Bild (Marke Italien, 2000): Auszug aus der
Kopie einer römischen Weltkarte von 250, die als Tabula Peutingeriana bekannt wurde]
5.3 Entstehung von Dörfern und Städten
Bei den Kastellen entstehen Kastell- Dörfer,
die auch für die Verpflegung und Versorgung der Soldaten gebraucht werden. Es
entstehen Land-Dörfer und Landstädte mit Handwerkern
und Händlern.
Die für die Römer so wichtigen Bäder
werden gebaut (Baden-Baden, Badenweiler, Heidenheim). Es entstehen Verwaltungseinheiten, civitates
mit Verwaltungsstädten. In diesen Verwaltungsstädten werden auch Handelshäuser
gebaut; religiöse Gebäude werden errichtet, und natürlich auch öffentliche
Bäder. Die Civitas
Sumelocenna (=Rottenburg) ist eine der größten
Verwaltungsstädte.
Als Stadt im Vollsinn, municipium, wird im Land zwischen Limes und Rhein nur
eine bezeichnet: Arae Flaviae, an der Stelle des heutigen Rottweil.
.5.4 Entstehung und Betrieb der Gutshöfe (villa rustica) Vor
allem entstehen viele Gutshöfe (= villa rustica), von
denen aus das Land bebaut wird. Auch sie waren vor allem für die Versorgung der
Soldaten notwendig.
Kolonisten, vermutlich meist verdiente
Kriegsveteranen, erhalten zunächst als Pächter das Land. Über 1300 solcher Gutshöfe
sind bis heute gefunden worden; Schätzungen gehen von etwa 5000 solcher Gutshöfe
aus. Nach Schätzungen lebten in jedem dieser Gutshöfe etwa 50 Personen (mit dem
gesamten "landwirtschaftlichen Personal"). Rechnet man diese Zahl auf die
Gesamtzahl der Gutshöfe hoch, so ergäbe das bei 5000 Gutshöfen etwa 250.000
Menschen. Die Gutshöfe liegen vor allem in den fruchtbaren
Löss-Gebieten des Neckartals und im Rheintal, und sie sind meist in der Nähe
der Verkehrsstraßen, auch der Wasserstraßen wie Enz oder Neckar von den Siedlern gebaut.
 Die ersten Gutshöfe, die noch im 1. Jahrhundert entstanden, wurden noch aus Holz
errichtet. Aber bald setzten sich Steinbauten durch; es entstanden die
charakteristischen Landhäuser mit dem Hauptgebäude mit einem Säulen-Portikus in der
Mitte, hervorragenden Risaliten an den Ecken, verschiedenen Kellergewölben, dazu
ein Bad, natürlich, Nebengebäude für die Lagerung der landwirtschaftlichen
Erzeugnisse und evtl. für das Vieh; das ganze von einer Mauer eingezäunt. Die ersten Gutshöfe, die noch im 1. Jahrhundert entstanden, wurden noch aus Holz
errichtet. Aber bald setzten sich Steinbauten durch; es entstanden die
charakteristischen Landhäuser mit dem Hauptgebäude mit einem Säulen-Portikus in der
Mitte, hervorragenden Risaliten an den Ecken, verschiedenen Kellergewölben, dazu
ein Bad, natürlich, Nebengebäude für die Lagerung der landwirtschaftlichen
Erzeugnisse und evtl. für das Vieh; das ganze von einer Mauer eingezäunt.
[Bild (Foto M. Ebener): Teilweise
rekonstruiertes und in einen Park eingebautes römisches Landgut bei
Enzberg/Mühlacker. Auf dem Bild ist auch noch die Größe des Haupthauses zu
erahnen; mit etwa 42 m Länge hatte es beträchtliche Ausmasse]
Durch archäologische Funde ist ziemlich
gut bekannt was von den Landwirten der Landhäuser auf den Feldern angebaut
wurde: Die ganze Vielfalt der Getreidearten (übrigens sehr ähnlich
unseren heutigen), von Obst und welches Gemüse.
 Unklar
und umstritten ist bisher, ob auch der Weinbau bereits in der römischen
Zeit in Südwestdeutschland eingeführt wurde. Sicher ist, dass Wein bekannt war
und getrunken wurde (s. dazu etwa den Römischen Weinkeller, der in Oberriexingen
ausgegraben wurde). Aber es dürfte sich meist wohl um importierten Wein
gehandelt haben, entweder aus Italien oder von Rhein und Mosel. Dass an Rhein
und Mosel der Weinbau von den Römern schon seit Anfang des Jahrtausends
eingeführt wurde ist unbestritten. Für den Weinbau in Südwestdeutschland in der
Römerzeit gibt es bisher als sehr vagen "Beweis" fast nur ein Gerät, das man als
Rebmesser deuten könnte, das man beim heutigen Lauffen gefunden hat. Unklar
und umstritten ist bisher, ob auch der Weinbau bereits in der römischen
Zeit in Südwestdeutschland eingeführt wurde. Sicher ist, dass Wein bekannt war
und getrunken wurde (s. dazu etwa den Römischen Weinkeller, der in Oberriexingen
ausgegraben wurde). Aber es dürfte sich meist wohl um importierten Wein
gehandelt haben, entweder aus Italien oder von Rhein und Mosel. Dass an Rhein
und Mosel der Weinbau von den Römern schon seit Anfang des Jahrtausends
eingeführt wurde ist unbestritten. Für den Weinbau in Südwestdeutschland in der
Römerzeit gibt es bisher als sehr vagen "Beweis" fast nur ein Gerät, das man als
Rebmesser deuten könnte, das man beim heutigen Lauffen gefunden hat.
[Bild (Briefmarke BRD, 1980): Zwei
Jahrtausende Weinbau in Mitteleuropa, eingeführt von den Römern; Anbau, Ernte
und Veredelung des Weines, Holzschnitte aus dem Lehrbuch "Rurelia commoda" von
Petrus de Crescentiis (1309)]
[Entwurf der Briefmarke: Poell]
5.5 Religionen im römischen
Siedlungsland Die Römer hatten ihre
Religionen mit ins Land gebracht; dafür gibt es viele archäologische Belege. Die
traditionellen römischen Götter mit Jupiter an der Spitze und ihre religiösen
Riten spielten offenbar eine große Rolle, sowohl bei den Soldaten als auch bei
den Siedlern. Auf den meisten Gutshöfen stand in der Mitte des Hofes eine
Jupiter-Giganten-Säule, auf der auch noch viele andere Götter abgebildet
waren. Daneben gab es neue Religionsformen,
von denen der vor allem bei Soldaten beliebte Mithras-Kult besonders
auffällig war. (Ein Mithrasheiligtum wurde z.B. auf der Ottmarsheimer Höhe bei
Mundelsheim im Kreis Ludwigsburg 1989 bei Bauarbeiten entdeckt und restauriert.)
[Spuren christlicher Gemeinden oder
christlicher Riten wurden bisher nicht gefunden, was überraschend ist.
Denn in der Zeit der römischen Besetzung des Landes, in den ersten 3
Jahrhunderten nach Christus, breitete sich das Christentum im römischen
Weltreich mit erstaunlicher Geschwindigkeit aus, es erfasste an anderen Stellen
Soldaten und Bauern, Beamte und Handwerker. So gab es im 3. Jahrhundert eine
christliche Gemeinde in Augsburg, der Hauptstadt Rätiens. Und es gab wohl auch
schon eine christliche Gemeinde in Konstanz. Aber offenbar nicht im
Land am Limes.]
6. Das Ende der Römerzeit
in Südwestdeutschland: Die Überwindung des Limes und die Besetzung des
Landes durch die Alamannen s.
dazu in der linken Spalte die Kurzbeschreibung zum
3. Jahrhundert mit Caracalla, Severus Alexander, Maximinus Thrax,
Gallienus u.a.
und der Überwindung des Limes durch die Alamannen
bis 260 n.Chr. Als die
Alamannen das Neckarland besetzten haben sie nicht die Zivilisation der Römer
einfach übernommen und fortgesetzt. Es erfolgt ein starker Kulturbruch: bei der
Baukultur, der Kultur der Gutshöfe, der Wohnkultur und der Landwirtschaft, der
Siedlungskultur. Ihre Wohnsiedlungen errichteten die Alamannen selten in den
noch vorhandenen Restdörfern der Römer, sondern an neuen Orten (z.B. auf dem
Runden Berg bei Urach); die Villae Rusticae wurden kaum von den Alamannen
bewohnt.
Immerhin
gibt es Belege dafür dass die Alamannen die vorhandenen römischen Gebäude
wenigstens als Steinbruch oder für Materiallager nutzten. Ein Beispiel dafür
bieten die Ausgrabungen eines römischen Landguts in Wurmlingen (bei Tuttlingen),
bei denen man fand, wie die Alamannen in den Resten eines römischen Badehauses
einer Villa Rustica einen Getreidespeicher eingebaut haben.
7.
Weitere Informationen und Quellen:
7.1: Weitere
Web-Informationen:
-
Weitere Web-Informationen zu den Römern in Süddeutschland:
http://www.lateinforum.de/roemer.htm
-
Weitere Web-Informationen zu den Römer-Museen in Hechingen, Rottweil,
Rottenburg, Walheim, Köngen:
http://www.bawue.de/~wmwerner/dtsch/archl_d2.html
- Weitere
Web-Informationen zum großen Reiterkastell Aalen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Kastell_Aalen
7.2: Literaturhinweise
zu den Römern in
Südwestdeutschland:
-
Nina Willburger: Unter römischer Herrschaft. Artikel (S. 81ff) im Katalog
des Landesmuseums Württemberg, Stuttgart, zur Neupräsentation 2012: Legendäre
Meisterwerke. Kulturgeschichte(n) aus Württemberg. Theiss-Verlag 2012
- Dieter Planck
(Hrsg.): Die Römer in Baden-Württemberg. Römerstätten und Museen von
Aalen bis Zwiefalten. Theiss-Verlag, 2005
- Philipp Filtzinger: Artikel Römerzeit [mit
den Abschnitten: Die Eroberung Südwestdeutschlands / Der
rechtsrheinische Limes / Besiedlung, Verwaltung, Kultur und Religion im
Limesgebiet / Verlust des Limesgebiets und spätrömische Zeit]
im "Handbuch der Baden-Württembergischen Geschichte" Band 1,1: Von der Urzeit
bis zum Ende der Staufer, dort S. 131ff. Klett-Cotta 2001
-
Hans Ulrich Huber: Zeitenwende rechts des Rheins - Rom und die Alamannen.
Artikel (S. 59ff) im Katalog/ Begleitband zur Ausstellung "Die Alamannen"
1997/1998 in Stuttgart, Zürich und Augsburg. Hrsg. Archäologisches Landesmuseum
Baden-Württemberg, Stuttgart 1997
- Dieter Planck: Die Römer in
Baden-Württemberg. Artikel (S. 37ff) im von R.Rinker und W. Setzler
herausgegebenen Sammelband "Die Geschichte Baden-Württembergs". Theiss-Verlag
1986
|
 Lexikon
Geschichte Baden+Württemberg: Die
Römer in Südwestdeutschland
Lexikon
Geschichte Baden+Württemberg: Die
Römer in Südwestdeutschland